Şişedeki Mesaj – Köşe Yazıları
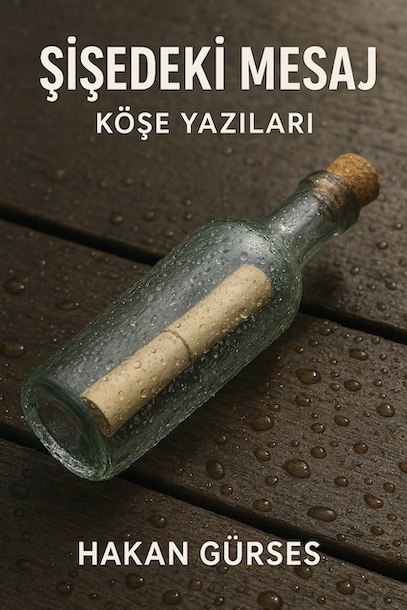
2004 ile 2021 arasında çıkan üç dergiye yazdığım Türkçe köşe yazılarından bir seçkiyi, Şişedeki Mesaj başlığı altında e-kitap olarak (pdf formatında) burada paylaşıyorum. Önsözden:
Peş peşe oluşan bu üç dergiye de düzenli biçimde köşe yazıları verdim. Türkiye’nin gündemine, Türkiye kökenli insanların buradaki hayatına, siyasalı belirleyen bazı kavram, teori veya düşünceye yönelik yazılar.
Geçenlerde arşivimi düzenlerken, bu Türkçe köşe yazılarım çarptı gözüme. Zaten gurbet koşullarında okuyucusuna ulaşıp ulaşmayacağını bilemediğim bu “şişedeki mesajların”, sanki hiç yazılmamışlar gibi yok olup gitmelerine gönlüm elvermedi. Dolayısıyla onların aşağı yukarı üçte ikisinden oluşan ve bugün de okunabileceğini umduğum bir seçkiyi, dijital kitap formatında yayımlamaya karar verdim.
Seçki, okumayı kolaylaştırmak hedefiyle tersten başlıyor, günümüze daha yakın sorulara cevap arayan son dönem yazılarıyla. Geçmiş gündemlere anında müdahale amacıyla yazılmış da olsalar, seçtiğim köşe yazılarının bugün hâlâ geçerliliğini koruyan bazı temel siyasal ve kültürel sorunları konu ettiğini düşünüyorum. Bir yandan da yakın tarihimizin bir tanığı bu kitap.